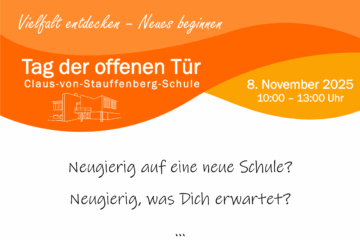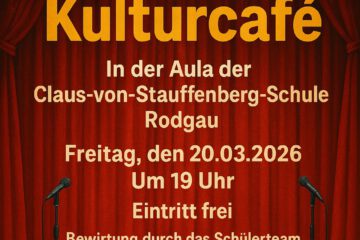Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi in der Claus-von-Stauffenberg-Schule



Die ersten sechs Lebensjahre lebte Eva Szepesi in der liebevollen Geborgenheit ihrer Familie und ihres Freundeskreises. Lange Haare, Zöpfe, Puppe Erika. Eine glückliche Kindheit. Dann änderte sich die Atmosphäre in der Schule, sie durfte nicht mehr im Chor mitsingen, musste auf Liebgewonnenes verzichten und auch viele Freundinnen wendeten sich von ihr ab. Die Shoah, die Judenverfolgung des Holocaust, hatte Ungarn erreicht, wo Eva Szepesi mit ihrem jüngeren Bruder Tamás aufwuchs. „Jemand hat sie aufgehetzt“, erklärte ihr ihr Vater das ausgrenzende Verhalten ihrer Schulkameradinnen. „Sie können nicht anders.“ Aber der Schmerz blieb. Mit elf Jahren kam für die heute 92-Jährige die Flucht, die Trennung von ihrer Familie und den Menschen, die sie kannte und liebte, und schließlich der Transport im stinkenden Viehwagon ins KZ Auschwitz-Birkenau. Fünfzig Jahre hatte sie von da an über das Erlebte geschwiegen, konnte es nicht verarbeiten. Heute berichtet die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande offen über das erfahrene Leid. „Sag, du seist 16 Jahre alt“, riet der damals 12-Jährigen eine Wärterin bei der Ankunft in Auschwitz. Sechzehnjährige wurden zur Arbeit herangezogen. Jüngere wurden entweder für medizinische Experimente eingesetzt oder gleich vergast. So überlebte Eva Szepesi das entwürdigende Eingangsszenario in das KZ mit Kopfrasur und kompletter Entkleidung bei eisigen Temperaturen. Man tätowierte ihr die Häftlingsnummer A26887 auf den Unterarm. Munition musste sie putzen und andere Aufgaben erledigen. Körperlich ging es ihr zunehmend schlechter. Zum „Todesmarsch“ nahm man sie nicht mit, da man sie in ihrem höchstgeschwächten Zustand bereits für Tod hielt. Sie überlebte die Grausamkeiten der dreimonatigen Gefangenschaft im KZ und konnte nach der Befreiung des Konzentrationslagers am 27. Januar 1945 wieder langsam zu Kräften kommen und in ihre ungarische Heimat zurückkehren. 1954 zog sie mit ihrem Ehemann Andor Szepesi nach Frankfurt, wo sie heute noch lebt.
„Ihr habt die Verantwortung, für die Zukunft wachsam zu sein!“, rief sie den Schülerinnen und Schülern der Claus-von-Stauffenberg-Schule in der vollbesetzten Aula zu und nahm sich die Zeit, auf jede der zahlreichen Schüler-Fragen einzugehen. Auf die Frage, wie sie heute über die Wärter denkt, antwortete sie: „Ich kann nicht hassen. … Ich bin traurig, ich erlebe Wut, aber ich kann nicht hassen.“ Und wie es ihr mit ihrer Häftlingsnummer geht? „Die Nummer gehört zu mir. Ich hätte die Tätowierung wegmachen lassen können, aber ich wollte es nicht. Es gehört zu mir.“ Jahrelang sah ihre Tochter Anita die Tätowierung, spürte die unausgesprochene Last, die ihre Mutter Tag für Tag trug und erlebte dann, wie sie nach fünfzig Jahren endlich ihr Schweigen beendete. Anlässlich einer Gedenkveranstaltung begann sie vor Jugendlichen, von ihren schlimmen Erlebnissen zu berichten. Es entstand die Autobiographie „Ein Mädchen allein auf der Flucht“. Viele Begegnungen an Schulen und anderen Orten folgten, in denen sie vor allen Dingen junge Menschen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und herausfordert. Nun durften wir Eva Szepesi, begleitet und unterstützt von ihrer Tochter Anita Schwarz, an der Claus-von-Stauffenberg-Schule erleben. Für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die vielen anwesenden Lehrkräfte war es eine ebenso beeindruckende wie auch sehr nachdenklich stimmende Begegnung, deren Botschaft und Eindrücke noch lange nachwirken werden.
Wir danken Eva Szepesi und ihrer Tochter Anita Schwarz für das Kommen, ihre Zeit und ihre offenen Worte. Darüber hinaus danken wir Petra Würz, die den Kontakt zu Eva Szepesi hergestellt und die Veranstaltung möglich gemacht hat. Außerdem danken wir der Stiftung der Sparkasse Langen-Seligenstadt für die finanzielle Unterstützung.